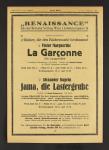Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 03.11.1923
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1923-11-03
- Erscheinungsdatum
- 03.11.1923
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- LDP: Zeitungen
- Zeitungen
- Saxonica
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19231103
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-192311034
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19231103
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1923
- Monat1923-11
- Tag1923-11-03
- Monat1923-11
- Jahr1923
-
7553
-
7554
-
7555
-
7556
-
7557
-
7558
-
7559
-
7560
-
7561
-
7562
-
7563
-
7564
-
7565
-
7566
-
7567
-
7568
-
7569
-
7570
-
7571
-
7572
-
7573
-
7574
-
7575
-
7576
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
7556 VLrsenblaU f. d. Dlschn. Buchhandel. Redaktioneller Teil. U 257, 3. November 1923. Dagegen sind vom Schutz ausgesperrt alle amtlichen Erlasse, die Verhandlungen von Behörden, die Berichte öffentlicher Ver waltungen und nun auch noch die Patentschriften. Ferner sind die bei öffentlichen Anlässen gehaltenen Reden der Berichterstattung überlassen. Die Tagesneuigkeiten und »Vermischten Nachrichten», sofern sie einfache Zeitungsmilteilungen, nicht eigentliche Artikel silid, stellen keine urheberrechtlich geschützten Schöpfungen dar. Schutzfähige Autoren. Es sind dies erstens alle Autoren schweizerischer Nationalität, sowohl hinsichtlich ihrer nicht herausgegebenen wie ihrer heraus- gegebenen Werke, wo immer in der Welt die letzteren erscheinen mögen; zweitens die Fremden, die ihre Werke erstmals in der Schweiz herausgeben, und drittens die Fremden, deren Werke in einem Land« erscheinen, das den Schweizern einen auf materieller, vom Bundesrat festgesetzter Gegenseitigkeit beruhenden Schutz ge währt. Das Domizil in der Schweiz, das als urheberrechtsbegrün dend galt, ist aus dem Gesetz verschwunden. Alz Autor gilt bis zum Beweise des Gegenteils, wer den bürgerlichen Namen oder sein künstlerisches Kennzeichen auf dgs Werk setzt oder als Urheber anläßlich von Darbietungen genannt wird. Zum ersten Male sind die Rechtsverhältnisse der Miturheber (als eine Rechtsgemeinschaft bei nicht unterscheidbarer Mitarbeit) und der anonymen und pseudonymen Autoren erwähnt, für die der Herausgeber, bzw. Verleger als präsumierter Rechtsnachfolger wäh rend 3V Jahren nach der Bekanntgabe di« Treuhänderschast über nimmt. Groß« Schwierigkeiten boten in den Vorberatungen der Expertenkommission die Decknamen. Sollten nicht solche, unter denen der Autor allgemein bekannt ist, z. B. T. Comüe, also die mit »notorischen Pseudonymen» herausgegebenen Werke als ortho- nyme behandelt werden? Der Gesetzgeber blieb aber, im Hinblick auf die Schwierigkeit, diese Notorietät juristisch zu fassen, unerbitt lich darin, daß der bürgerliche Name des Autors oder der Autorin angegeben werden muß, wenn der volle Schutz von 39 Jahren post mortem auetoris erlangt werden soll. Wenn nun im Verlauf der ersten 39 Jahre «in anonymes oder pseudonymes Werk, mit diesem bürgerlichen Namen versehen, neu herauskommt, so ist dieser Vor schrift des Gesetzes Genüge geleistet. Wie aber, wenn z. B. ein wissenschaftliches Werk zu keiner zweiten, mit dem bürgerlichen Namen des Gelehrten bezeichnten Ausgabe gelangt, wenn es unter seinem Namen auch nicht öffentlich vorgetragen, aufgefühct oder vorgeführt werden kann und dennoch der volle auf dem Tod des Autors basierende Schutz erlangt weiden soll? Das Gesetz, das sich über diesen Punkt ausschweigt, enthält hier eine kleine Lücke, aber sicherlich mehr in der Theorie, denn in der Praxis. Offenbar genügt irgendeine Bekanntmachung mit Namensnennung. Grundsätzlich wird das Autorrecht nur den Autoren, also physischen Personen zuteil, sodaß die direkt« Schutzfähigkeit juristi scher Personen, wie Behörden, Vereine, Akademien, Firmen, Aktien gesellschaften, aufgehört hat. Dies« juristischen Personen genießen Urheberrecht nur insofern, als sie sich von den physischen Autoren stillschweigend oder noch besser durch «inen regelrechten Vertrag Urheberrecht haben übertragen lassen, was von graphischen Anstalten und überhaupt von Arbeitgebern besonders zu beachten ist. Damit ist auch die Wichtigkeit der stets eng auszulegenden Übertragung genügend betont. Nur die erworbenen Teilrechte werden als abgetreten angesehen, was aber durchaus nicht sagen will, daß der Rechtsnachfolger sich vom Autor alle Recht« in Bausch und Bogen, worunter auch solche Recht«, die er gar nicht auszu beuten gedenkt, erwerben und dadurch den Autor mißtrauisch machen sollte. Ein Verlagsvertrag z. B. sollte sich in der Regel darauf beschränken, zu stipulieren, was Art. 389 O.R. als Zweck desselben angibt, nämlich »das Werk zu vervielfältigen und in Vertrieb zu setzen» und sich laut Art. 381 O.R. diejenigen Rechte insoweit und solange übertragen zu lassen, als es »für die Aus führung des Vertrages» erforderlich ist. Mit dem urheberrechtlich unhaltbaren, unsympathischen Be- stellerrecht hat das neue Gesetz so ziemlich (außer bei Porträts) aufgeräumt. Schutzfrist und Schutzerwerb. Die Verlängerung der Schutzfrist von 39 auf 59 Jahr« post mortem, wie die Berner Übereinkunft sie als Normaldauer empfiehlt, will die Schweiz vorläufig nicht miimachen. Sie verlängert die jetzigen Fristen nur insofern, als sie, wie in den meisten Gesetzen, vom Ende des Todes- oder Hcrausgabcjahres an lausen. Gegen jede den Herausgeber begünstigende »ücküio prümeps» ist auch die Bestimmung gerichtet, daß die nachgelassenen Werke bloß 39 Jahre nach der Herausgabe geschützt werden können, daß aber die Gemeinsreiheit in allen Fällen 59 Jahre (im Entwurf 69 Jahre) nach dem Tode des Urhebers für solche Werke eintrcien mutz. Unter dem neuen Gesetz könnt« ein Werk wie der »Herr Esau», das unter dem alten Gesetz 39 Jahre post xubUcstloaem ge schützt ist und auch jetzt noch solange geschützt bleibt, keinen Schutz mehr beanspruchen. Der Verleger solcher nachgelassenen, erst über 59 Jahre nach dem Tode des Autors zur Veröffentlichung gelan genden Werke ist, da dies« sosort gemeinfrei werden, mit seiner Herausgabe nur noch der Diener allgemeiner Interessen. Die Erlangung des Schutzes ist wie in der Berner Union, so im Inlands nunmehr von allen Förmlichkeiten irgendwelcher Art befreit. Rcchtsinhalt. Der Autor hat das Recht, sein Werk an die Öffentlichkeit zu bringen und es dort zu nutzen. Di« private Benutzung ist jeder mann Vorbehalten, nur darf sie in keiner Weise die Grenzen der Häuslichkeit überschreiten und ebensowenig einen Gewinnzweck verfolgen. Das zeniral« Recht am veröffentlichten Werk ist das Recht, dasselbe wiederzugeben, und zwar -durch irgendein Verfahren» wiederzugeben. Diese schließlich von den Räten aus dem zweiten Entwurf übernommene Beifügung vermag für die Zukunft in der Anwendung durch einsichtige Richter außerordentlich segensreich zu wirken und der Abschreiberei sowie dem Kopieren durch irgend ein Reproduktionsmittel den Riegel zu stecken. Dieses zentrale Recht umfaßt das ausschließliche Recht aus unveränderte oder veränderte Wiedergabe (Bearbeitung im weiteren' Sinn). Neu ist sodann die ausdrückliche Anerkennung des Rechts, Exemplare des vervielfältigten Werkes zu verkaufen, seil zu halten oder sonst in Verkehr zu bringen. Diese Kontrolle wird, wenn rich tig gehandhabt, zu einer scharfen Waffe werden, um dem Schmuggel und der Schieberei entgegenzutreten. Unter dieses Recht fällt unzweifelhaft auch das allerdings gegenwärtig mehr theoretische Recht, das gewerbsmäßige Bücherverleihen zu gestatten oder nicht (siehe Votum von Bundesrichter Reichel, Expertenkommission 1914, S. 94 und 95). Unter das Urheberrecht fällt ferner die Befugnis, öffentliche Vorträge von Werken zu gewinnsüchtigen Zwecken während der Schutzdauer — nicht nur wie in Deutschland bis zum Erscheinen des Werkes — zu überwachen. Das in Deutschland anerkannt« Recht zur öffentlichen Mitteilung des wesentlichen Inhaltes des Werkes bis zu dessen Bekanntgabe ist dagegen als überflüssig nicht eingesührt worden. Das Recht der öffentlichen Aufführung musikalischer, drama tischer und dramatisch-musikalischer Werke ist vorbehaltlos und unbedingt, somit ohne Konzessionen an Liebhabergesellschaften und wohltätige Veranstaltungen anerkannt. Dasselbe ist der Fall mit dem Recht der Vorführung in Projek tionen usw. und dem Recht zur öffentlichen Ausstellung noch nicht bckanntgegebener Werke. Endlich ist noch zu erwähnen das Recht der Erstellung oder Ausführung von Kunst- und Bauwerken oder bildlicher Darstellun gen wissenschaftlicher (jedoch nicht technischer) Natur. Das Bearbeitungsrecht oder das Recht, auch die Wiedergabe mit Abänderungen zu überwachen, ist nicht ausdrücklich geordnet wie im Art. 12 der revidierten Berner Übereinkunft, sondern durch Beispiele (»insbesondere») illustriert; es umfaßt das übersetzungs recht, das nunmehr von der im alten Gesetz vorgesehenen Benutzungs- frist von 5 Jahren gänzlich befreit und dem Wiedergaberecht völlig gleichgestellt ist; sodann das Recht der Verfilmung und das Recht der Übertragung auf mechanische Instrumente.
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht