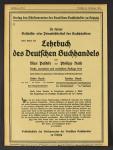Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 18.02.1913
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1913-02-18
- Erscheinungsdatum
- 18.02.1913
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- Saxonica
- Zeitungen
- LDP: Zeitungen
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19130218
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-191302189
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19130218
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1913
- Monat1913-02
- Tag1913-02-18
- Monat1913-02
- Jahr1913
-
1843
-
1844
-
1845
-
1846
-
1847
-
1848
-
1849
-
1850
-
1851
-
1852
-
1853
-
1854
-
1855
-
1856
-
1857
-
1858
-
1859
-
1860
-
1861
-
1862
-
1863
-
1864
-
-
-
-
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
„1/ 40, 18. Februar 1913. Redaktioneller Teil. (Fortsetzung zu Leite 181tt.) Ein Mitglied des Vorstandes des Vereins trat später mit ihm in Ver bindung, um ein von ihm angeborenes Warenlager zu kaufen. Da eine Anzahl der Mitglieder des Vereins dies mit den Satzungen für nicht vereinbar hielt, wurde eine Mitgliederversammlung zur Erörterung hierüber einberufen. Nach dem Vortrage eines Vorstandsmitgliedes über diese Frage, an die sich eine eingehende Diskussion anschloß, faßte der Beklagte als Vorsitzender die Ansicht der Vereinsmitglieder dahin zusammen, daß diese also an den Kläger nichts verkaufen und von ihm nichts kaufen dürften. Nach der Behauptung des Klägers hat er noch hinzugefügt, daß jedes Vereinsmitglied, das dieses Verbot überträte, selber boykottiert werden würde, daß ferner das Verbot auch den Ver lag des Klägers sowie den Ankauf seines ganzen Geschäftes betreffe. Weiterhin behauptet der Klüger, der Beklagte habe auch seine Wiederaufnahme in den Verein abgelehut und geäußert, er, der Kläger, müsse für seinen Widerstand ruiniert werden. Der Kläger ist der Ansicht, daß dieser gegen ihn verhängte Boykott gegen die guten Sitten verstoße, und stellt daher, Klage erhebend, den Antrag, 1. den Beklagten zu verurteilen, Aufforderungen an dritte Personen zu unterlassen, bei dem Kläger nicht zu kaufen oder ihni etwas zu verkaufen: 2. festzustellen, daß der Beklagte für allen durch diese Aufforderung entstandenen und entstehenden Schaden verantwortlich sei, 4. das Urteil eventuell gegen Sicherheitsleistung für vorläufig voll streckbar zu erklären. Der Beklagte bestreitet die Behauptungen des Klägers und be antragt Abweisung der Klage. Er macht folgendes geltend: Der Kläger habe nach seinem Ausschlüsse aus dem Verein wieder holt versucht, den Boykott zu umgehen. Er habe insbesondere ganze Musikaliengeschäfte aufgekauft, unter anderem Namen betrieben und auf diese Weise versucht, Musikalien zu erlangen, um sie alsdann an schleudernde Warenhäuser weiterzugeben. Er habe auch die Gewohn heit der Buchhändler, ihre Bestellzettel nicht zu unterschreiben, sondern nur zu unterstempeln, dazu benutzt, mit Hilfe eines nachgemachten Stem pels auf den Namen der Firma Neimann in Berlin, Musikalien zu erlangen, um auch diese an schleudernde Warenhäuser weiterzugeben. Der Beklagte führt ferner aus, der Boykott sei schon deshalb nicht sittenwidrig, weil er sich nur auf den Sortimentshandel, nicht auch auf den Verlagshandel des Klägers beziehe und weil die Berliner Musika lienhändler im Interesse der Erhaltung ihrer wirtschaftlichen Existenz gezwungen seien, mit aller Schärfe gegen solche Mitglieder vorzugchen, die Musikalien an schleudernde Warenhäuser lieferten. Der Kläger bestreitet diese Behauptungen. Im übrigen wird wegen der An- und Ausführungen der Parteien auf den Inhalt ihrer vor getragenen Schriftsätze Bezug genommen. Gemäß dem Beschlüsse vom 20. April (Blatt 56/57), und 2. Oktober 1012 (Blatt 85) sind die Zeugen Albers, Neumann, Nitschmann, Nühle, Kühne und Fago vernommen worden. Auf den vorgetragenen Inhalt der Vernehmungsprotokolle vom 11. Juni (Blatt 67/68), 9. Juli (Blatt 77/78) und 15. Oktober 1012 (Blatt 91/92) wird verwiesen. Der Kläger hat nunmehr dem Beklagten den Eid über die zum Gegenstände des Beweisbeschlusses vom 20. April 1912 gemachten Be hauptungen zugeschobcn. Der Beklagte hat den Eid angenommen, ihn aber für unerheblich erklärt. Entscheidungsgründe. Zwar kann eine Haftung des Beklagten aus dem Gesetze über den unlauteren Wettbewerb nicht hergeleitet werden, denn sowohl § 1 als auch § 14 dieses Gesetzes verlangen, baß der unlautere Wettbewerb »zu Zwecken des Wettbewerbs« erfolgt ist, und diese Voraussetzung ist dann nicht gegeben, wenn Jntcressenkämpfe zugunsten des ganzen Ge werbes ausgefochten werden. Denn das Streben geht in diesem Falle nicht dahin, auf Kosten des Gegners einzelne Personen oder kleinere Interessengruppen zu fördern, und außerdem ist der Hauptzweck des Boykotts nicht die Schädigung des Gegners, sondern nur die Hinderung des Gegners, den Boykottierenden selber Schaden zuzufügen, wenn allerdings damit auch eine Schädigung des Boykottierten verbunden ist. (Entscheidung des Reichsgerichts in Zivilsachen, Band, 56 Seite 271.) Aus § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Kläger dagegen, die Nichtigkeit seiner Sachdarstellung vorausgesetzt, den mit der Klage geltend gemachten Anspruch ableiten. Ein eingerichteter Gewerbebetrieb ist zu dem in Absatz 1 dieses Paragraphen erwähnten Rechte zu rechnen. (Vergl. Entscheidung des Reichsgerichts Band 64 Seite 53.) Zwar verpflichtet nicht jede Schädi gung eines der in 8 823 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches er wähnten Rechte zum Schadenersätze, vielmehr muß die Schädigung, ab gesehen von der Schuldfrage, auch widerrechtlich sein. Nun ist aber jeder an sich berechtigt, wenn er mit einem anderen einen Vertrag abschließt, darin Abmachungen zu treffen, durch die ein Dritter ge schädigt wird. Diese Abmachungen werden nur dann rechtswidrig, wenn eine Rechtspflicht zu ihrer Unterlassung entweder allgemein oder aber gerade dem Betroffenen gegenüber besteht. Eine solche Nechtspflicht zur Unterlassung liegt aber nach allgemeinen Nechtsgrund- sätzen dann vor, wenn der Boykott gegen die guten Sitten verstößt. Nun verstößt ein Boykott au sich nicht gegen die guten Sitten; er ist ein Kampfmittel und steht als solches etwa dem Streik oder einer Aussperrung gleich, die sämtlich an sich nichts Sittenwidriges dar stellen. Indessen kann ein Boykott entweder durch seinen Zweck oder infolge der darin angewandten Mittel einen Verstoß gegen die guten Sitten enthalten. So z. B., wenn er lediglich aus Nachsucht veran staltet wird oder aber n u r den Schaden anderer Personen bezweckt, d. h. nur aus Schikane veranstaltet wird, wobei es jedoch nicht ge nügt, daß diese Ziele neben anderen Zwecken maßgebend sind, viel mehr müssen sie den Hauptzweck bilden. Daß diese Voraussetzung hier nicht vorliegt, bedarf keiner weiteren Erörterung, denn die Musi kalienhändler sind, wie gerichtsbekaunt, durch die Musikalien zu Schleu derpreisen verkaufenden Warenhäuser in ihrer Existenz bedroht, und der gegen den Kläger verhängte Boykott diente somit offenbar der gebotenen Selbsterhaltung. Als Mittel, die einen Boykott sittenwidrig machen können, kommen z. B. Verleumdung oder Bedrohung des Gegners oder Täuschung des Publikums durch das Arbeiten mit unwahren Tatsachen in Betracht. Daß solche Mittel aber im vorliegenden Falle angewandt worden seien, behauptet der Kläger selbst nicht. Endlich kann ein Boykott noch da durch einen Verstoß gegen die guten Sitten darstellen, daß der dem Boykottierten zugefügte Schaden ganz unverhältnismäßig groß ist, gegenüber dem durch den Boykott für dessen Veranstalter erstrebten Gewinn. Diese Voraussetzung wird meistens dann vorliegen, wenn durch deu Boykott die gewerbliche Existenz des Boykottierten gänzlich oder nahezu vernichtet wird, es sei denn, daß die Boykottierenden deu Boykott zur Erhaltung ihrer eigenen wirtschaftlichen Existenz zu verhängen gezwungen sind. Diese Voraussetzung der Sittenwidrigkeit eines Boykotts hat der Kläger zwar schlüssig behauptet, indessen hat die Beweisaufnahme er geben, daß der Beklagte zwar in der fraglichen Vereinsversammlung zusammcnfassend erklärt hat, nach der Anschauung der Vcreinsmit- glieöer sei also ein Geschäftsverkehr mit dem Kläger verboten, daß sich dieses Verbot jedoch nur auf den Sortimentshandel, nicht auch aus den Verlagshandel des Klägers bezogen habe, und daß er den Ankauf der ganzen Musikalienhandlung des Klägers sogar für dringend wün schenswert erklärt hat. Ferner ist nicht erwiesen, daß der Beklagte die Aufnahme des Klägers in den Verein abgelehnt habe, vielmehr hat der Beklagte im Gegenteil gegenüber dem Zeugen Nitschmann es für bedauerlich erklärt, daß der Kläger lieber gegen den Verein als mit dein Verein arbeiten wolle. Gegenüber diesem klaren Beweisergebnis ist der dem Beklagten nach der Beweisaufnahme zugeschobene Eid gemäß 8 446 der Zivilpro zeßordnung unzulässig. In einem in dieser Weise beschränkten Boykott, der offenbar nicht geeignet ist oder sogar zum Zweck hat, die wirtschaftliche Existenz des Gegners zu vernichten, kann aber nichts Sittenwidriges gesehen werden, zumal da zu berücksichtigen ist, daß dieser Boykott, wie bereits ausgefiihrt ist, notwendig war, um die bedrohte wirtschaftliche Existenz der hinter dem Beklagten stehenden Musikalienhändler zu erhalten. Die Klage mar daher als unbegründet abzuweisen. Die Kosten entscheidung folgt aus 8 91 der Zivilprozeßordnung. gez. Camp. v. Pochhammer. Becker. Ausgefertigt Berlin, den 8. November 1912. gez. Loewe, Gerichtsschreiber des Königlichen Landgerichts I. Kleine Mitteilungen. Uber die Literaturkonvention zwischen Rußland und Deutschland haben am 17. d. M. in den Privatränmen des russischen Ministers des Auswärtigen Sasonow in Petersburg Verhandlungen begonnen. Als Vorsitzende mit gleichen Rechten fungieren russischerseits der Gehilfe des Justizministers Hofmeister Werewkin und deutscherseits Geheimer Le gationsrat 7)r. Goebel v. Harrant, Vortragender Rat im Auswärtigen Amt. Als Delegierte Deutschlands nehmen an der Konferenz ferner teil: der Präsident des Reichspatentamts Nobilski, vom Reichs justizamt Geheimer Oberregierungsrat Oegg und vom Auswärtigen Amt vr. Graf v. Lehndorf. Zur Gründung des Deutschen Rheinmuseums. In der alten Kaiserstadt und Hauptstadt der Nheinpfalz Speyer tagte am 8. und 0. Februar die Konferenz zur Gründung des »Deutschen Rheinmuseums« in Koblenz, an der unter bekannten Persönlichkeiten auch der Ober-
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht