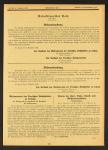Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 06.12.1923
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1923-12-06
- Erscheinungsdatum
- 06.12.1923
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- LDP: Zeitungen
- Zeitungen
- Saxonica
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19231206
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-192312061
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19231206
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1923
- Monat1923-12
- Tag1923-12-06
- Monat1923-12
- Jahr1923
-
8285
-
8286
-
8287
-
8288
-
8289
-
8290
-
8291
-
8292
-
8293
-
8294
-
8295
-
8296
-
8297
-
8298
-
8299
-
8300
-
8301
-
8302
-
8303
-
8304 8305
-
8306
-
8307
-
8308
-
8309
-
8310
-
8311
-
8312
-
8313
-
8314
-
8315
-
8316
-
8317
-
8318
-
8319
-
8320
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
8394 v«rl-nb>»u I. d. Dtlchn. Suchlstnd-I. Ferttge Bücher. 283, 6. Dezember ISA, Thomas Mann in - Bücher von Adolf von Hahfeld: Franziskus / Sin Roman Mil «in» Umschlagz-ichnunq von Ernst Barlach 4.-10 Tausend / broschier« 2.-, gebunden 3 — Gz. Oie Lemminge / Ein Roman 4.-5. Tausend / broschiert 2.—, gebunden 3 — Gz. Aufsätze über Kunst und Kultur 4.- 3. Tausend / broschiert 2.-, gebunden 3.— Gz. Gedichte 3.-4. Tausend / broschiert 4.50, gebunden 2.50 Gz. Ich liesere 11/10 mli 4» auch ««mischt / Schlüsselzahl d-s B.-L., Aus. lieseeung i>irel>, in Leipzig und Wien durch die Liierarla. Paul Sieegemann, Verlag, Hannover. .—. Thomas Mann: Über Adolf von Hatzfeld -Unter einige» guten Dinge», Sic ich kürzlich las, gedenke ich der Bücher Aöols von Hnßjelds besonders dankbar. Der junge westsaiilchc Dichter lenkte die Aulinerksainkeit der Literatursrcundc vor Jahr und Tag durch seinen Erstlingsroman »Franziskus» aus sich, eine Jünglings-Autobiographie, deren zarte Trägst, deren nobler und emp- sundencr Bortrag unvergessen sind. Eiu Band »Gedicht c« liegt vor, dazu ein zweiter Roman, »D i e Le in in ingc«, endlich eine Sammlung »Aussätze« über geistige uud soziale Gegenstände, deren Bielsalt Zeugnis ablegt sür die kluge Umsicht und sittliche Lcbeusauteilnahmc eines Dichters, Ser seit dem tragischen Abschlusl schwerer Jugcndwirrcu in ewigem Dunkel lebt. Ich las »Die Lemminge« mit grösstem Anteil. Das dichte rische Geheimnis des Buches ist beschlossen in anderthalb Seite», die auch räumlich in seiner Mitte stehen und zugleich die Erklärung seines sonderbaren Titels geben. Es ist da die Rede von einer Tierart des nördlichen Schweden, kleinen Nagetieren, Wühlmäusen, die einer merk würdigen Massenpsychose unterliegen, einem sanatischcn Wandertriebe ins Berderbc». Aus den Höhen der Berge brechen sic ohne erkenn baren Grund zu Tausenden aus, wimmeln in unauihaltsamcm Zuge, ge trieben von einem unbezähmbaren Drang, zur Ebene, zur Uiiste hinab, stürzen sich kopsübcr ins Meer und sinden jo in den Wellen den Tod. Bon dieser Erscheinung erzählt Iwan Wagner, der Held des Romans, und er sägt hinzu: »Es gibt auch Menschen, Fräulein Alt- manu, die Lemminge sind. Darin liegt der Grund, dag alle, die einen solchen Menschen umgeben, sich von ihm angczogen sühlen. Sie ahnen ganz lies sciu Schicksal. Er ist ein Wirbel, der sich um seine Achse dreht, abgeschlossen und in sich kreisrund vollendet. Er dreht sich uud zieht immer i» seiner Mitte in die Ticsc, abgeschlossen, fertig, ohne Hilsc, ruhevoll in seiner unheimlichen Drehkraft, die kaum eine kleine Unruhe der Fläche bemerken lägt. Er ist unveränderlich wie Stein und Eisen. In ihm ist nichts mehr slichcnd. Alles ist zur Todesruhc gekommen, in ihm selbst sertig, nach auhcn abgeschlossen, unabänderlich durch alle Zeiten. Eigentlich könnte er auch ohne Augen leben. Sein Gehirn hraucht keine neuen Eindrnstsbildcr z» cmpsangcn. Er erbte einen ganzen scrtigcn Bildcrkastcn: seine Bcltvorstcllungcn«. Das Buch wird bedeutend durch diesen Helden, den eine Frau, die sich verzwciselt noch dagegen wehrt, »in seiner Milte in die Tiese ge zogen zu werden«, so sicht: nordisch, eckig, mit hcrbgcschntttencn Ge- sichtszllgcn, sein Haar glatt, blond und streng um eine selten schön ge sonnte Stirn gelegt, eine scharse Stirn dies . .. »Wo mochte der Ursprung seines Wesens sei», das aus den Ttcsen des Bösen und des Herrliche» quoll? Wer war dieser Mau», der die Häßlichkeiten und Gemeinheiten eines bösen Geistes mit erhabenen Ge danken paarte?« Ja, wer ist er? Ein Dichter mutmaßlich, ein romantischer Held, eitel, als wäre er von Lcrmantoss, lyrisch geheimnisvoll wie Hamsuns Nagel und Glahu, und leicht objektiviert durch die Ein schaltung eines »Schreibers dieser Zeilen« und »Geschichtenerzählers«, der uns bittet, »cs ihm nicht als Indiskretion anzurechnen, wenn er Ereignisse, die erst in jüngster Zeit . . .« Man kennt das. Solche Kunstschcrze gehen sozusagen aus dem eingeborenen Objektivismus des Epos hervor, dessen Vortrag ja niemals ein Reden des Autors ist, dcS »moasiour«, über den Fl ändert sich lustig macht, sondern eine Selbstaussage der Dinge durch das Medium des Dichters, mit dessen Subjektivität sic ihre Objektivität zu einem Ergebnis vermischen, das die Ästhetik als »Stil« bezeichnet. Darum ist das Erzählen etwas voll ständig anderes als das Schreiben, und zwar unterscheidet sich jenes von diesem durch seine Jndirckthcit, die sogar am scinstcn uud ver schlagensten sein kann, wenn die innere Objektivität des Werkes durch eine humoristisch-scheinbare Direktheit verschleiert wird, wenn also dennoch eiu »inoasiour« sich meldet und peroriert, der aber keineswegs identisch mit dem epischen Autor, sondern ein singierter und schatten hafter Beobachter ist, der etwa mit der Nachricht beginnt, in »unserer Stadt« hätten sich kürzlich einige sonderbare, die össcntliche Meinung beunruhigende und nicht restlos ausgcklärtc Ereignisse zugctragcn, deren Hergang er nun, so gut cs ihm gegeben sei und soweit seine Einsicht reiche, entwickeln wolle. über Adolf von Hahf 283, 6. Dezember 1923. Fertige Bücher. Börsenblatt f. b. Ltschn. Buchhanbcl. ZA05 frankfurter Zeitung In dieser Technik schwakhajt kommentierender Scheindircktheit hat Dostolewskt ganze Welten komponiert. Bei Hatzfeld, der das Prinzip von Dostojewskis über nimmt, ist cs nicht anders — kein schwererer Vorwurf angesichts eines solchen Präzedenzfalles, aber Anlaß eben doch zu einer stiltritifchen Be wertung. »Einen der legten Frühlinge verdrachte Iwan Wagner in einer kleinen Stadt jenes hügeligen Geländes, das sich in leichten und heiteren Schwingungen zu den Borbergcn hinzieht, welche die Verbin dung mit den höheren und gewaltigeren Gebirgszügen des Allgäu bil den«. Das ist reine Parodie. Es ist, wie wenn heute einer ansinge: »Der Rhcingau . . . jener begünstigte Landstrich, welcher, gelinde und ohne Schroffheit sowohl in Hinsicht aus die Wittcrungsverhältnisse, wie aus die Bodenbcjchajsenhcit, reich mit Städten und Ortschaften besetzt und sröhlich bevölkert, wohl zu den lieblichsten der bewohnten Erde ge hört«. Es ist Spaß, Spiel und Fiktion: die Stimme des zweiten, eingc- jchobencn Autors, des »Schreibers dieser Zeilen«, der sich in höchst schriftstellerischen Wendungen ergeht, gewinnend, altmodisch und naiv bis zur Drolligkeit. Wenn cs aber Ernst wird, wenn die Dinge durch das Medium des epischen Dichters sich selbst aussingen, so klingt cs so: »Dann durchraste ein Auto die Nacht. Mond, der plötzlich anjschwebte, versank, Plätze bogen aus. Wälder sprangen es an wie geile Hunde und sielen zurülk. Bläuliche gläserne Stille. Iwan Wagner floh, sloh vor Leonic«. Das ist was anderes. Cs ist die Stimme des wirklichen und unverstellten Autors, neueste Erzählung mit einem starken Einschlag dessen, was man Expressionismus nennt. Keine Spur mehr von dem angenehmen Beobachter mit den wohlgesügtcn Relativsätzen und den »heiteren Schwingungen«. Aber wo ist er geblieben? Wo das jormale Prinzip? Ich hojse, der Dichter wird es mir »nicht als Indiskretion auslcgen«, wenn ich aus den Stilbruch aufmerksam mache, der, mehr oder weniger deutlich, durch sein ganzes Werk läust. Es handelt sich mehr um die Feststellung von etwas kaum Vermeidlichem, als um wirk liche Beanstandung. Iwan Wagner, der Held der Dichtung, hat Augen zu sehen. Sein Gehirn empfängt Eindrucksbilder in bedrängender Fülle. Er empfängt, wie es von ihm heisrt, »in sich das Bild der ewigen Schöpfung«. Es erfüllt ihn »der unermeßliche Reichtum der Welt und der dumpfe Rausch seines Blutes«. Eine Lichtslut, vielfach sarbig gebrochen, waltet in dem Buch, eine Andacht und dankbare Inbrunst des RaturschauenS, die ergreift! »Die Berge begrenzten in strahlendem Weis; das Blau des Horizontes, die Sonne vergoldete die Strotzen und spiegelte sich in den glitzernden Gewässern der Alter. Um das Schlotz slog cs leuchtend aus in dunklem Braun. Die Menschen zeigten lachende Gesichter, und geheimnisvolle Schatten trieben sich in allen Ecken umher«. Strahlen, Spiegeln, Leuchten, Lachen und Schattenspiel — unersättlich. »Es war ein Leuchten in der Lust, und der kleine Flutz sing cs spiegelnd auf, und über die Gewässer schossen herrliche Strahlen hin und her, und um die Mittagszeit geschah cs, das; braune Wolken den Himmel bcsuhren. Es war ein ewiges Glitzern im grünen Sommer. Die kleine Fahne flatterte rot auf dem Schlotz. Die Sonne ging in kristallenem Morgen aus ihren steilen Weg, und die Vollmondnächtc erfüllten und bezauber ten daö Land mit betörendem Dust«. Das ist ja deutsche Narurromantik. ES könnte in Eichcndorsfs Taugenichts stehen und ist ein Beispiel dafür, wie in dem Dichter Liebenswert Überliefertes sich mit neuesten Stilcrgebnisfcn mischt. Cs ist sehr schön, absolut genommen, und ich weis, wohl, das; Kunstwerke absolut und ohne Voraussetzungen ge nommen werden müssen. Und doch soll niemand mir die menschliche Rührung verwehren, mit der ich diese selige Dankbarkeit inneren Gesichts doppelt als Dich tung empfinde. Die Lichtvision — wird sie auch niemals verblassen? Es ist viel von der Inbrunst des »Verlas; mich nicht!« in der seelischen Natur- umarmung des Dichters oder seines Helden, in diesem tastenden, lau schenden Sich-anschmiegcn des ganzen Körpers an die Brust der Erde . . . »In der Ferne stürzte die Wollust der Berge lawinen- donncrnd zu Tal. Er vernahm um sich das leise Sickern des Wassers, das in die Wurzeln der Gräser und Bäume drang. Die Samen schwellten und trieben Blätter und Blüten in das Licht und das Glän zen des Tages. Tic unendlichen Quellen jlosscn von den Bergen und den Hügeln und erfüllten das schimmernde Lal mit der Fröhlichleit der Wedenblüten. Ungeheure Freude brach ans der Erde in erhabener Feier der Auferstehung. Die Kruste der Erde sprang, die Rinden der Bäume dufteten von Harz, und alles drängte in taufend Schwellungen zum Leben . . . « Man verzeihe die Anführungen, die Beispiele, aber ich lasse das Buch so gern erklingen, und mich ergreist die fast angstvolle Innig keit, mit der hier erlebt wird, dies Für-einandcr-cintrctcn der be gierigen Sinne, bei dem das heimliche Sickern des Wassers zu den Wurzeln sich zuerst in die noch dunkle Vision des Samenschwcllcns und dann in die Lichtvision der in den Tag getriebenen Blüten ver wandelt. »Das Sonnenlicht roch. Iwan Wagner roch das Sonnen licht. Er sagte zu Herrn König: Riechen Sie das Sonnenlicht und sehen Sie, wie der Tust sichtbar wird?« Das Kapital-Kapitel des Romans, die 8eeue a lairo, ist eine Lichtajjärc: sie spielt während einer Lonncnsinsternis und gehört in ihrer stillen Kühnheit zum Merkwürdigsten, was gegenwärtig Erzäh lung geschaffen. Ich sage nichts weiter darüber. Ich unterlasse cs, die Handlung dcS Buches zu anallisicrcn, die innerlich, schwierig und bitter ist, denn cs geht darin um Liebe und Einsamkeit. ES geht um den Gram, der die Liebe zum Lebendigen in Hatz verkehrt, und ich habe dabei die andere stärkste Szene im Sinne: die am Weiher mit dem Froschlaich, wo der Mann, der »seinen Samen hätte wegwcrsen können, so einsam war er«, die einsame Frau belauscht, wie sie in traurigster Bosheit die schleimigen kanlquappcnbeutel mit dem Stock zersticht. Das alte Münster, die Geburtsstadt des Helden und seines Poeten, spielt mit seiner Architektur, seiner Geschichte, seiner Landschaft in den Roman hinein, wie denn eine aristokratische Hcimatlicbe und Erdvcrbundcnheit zu seinem Grundgcsühl gehört. Dann sind da noch die »Gedicht e«, ein schmaler Band, in dem ich Einiges ausrichtig liebe. Aber ich bin kritisch zu unerfahren, um mir Rat zu wissen, wie man Gedichte besprechen, charakterisieren soll. Ich möchte ansührcn und aufzcigen, was meinem inneren Ohre wvhl- gctan, aber ich weiß wohl, das; das eine wenn auch gerade, so doch stümperhafte und vor allem Platz raubende Methode ist. Was ist die Tonika, der Orgclpnnkt? »Natur, Natur, gewiegt an deiner Brust«. Das Lchlutzwort eines der Lieder enthält ihn. Das ist nicht sehr grotz- städtisch-sortgcschrittcn, aber eS hat etwas Ewiges, was des Fort schrittes entraten mag, und das Glücklichste, was sich über diese Ge dichte sagen läßt, ist eben dies, datz sic Lyrik sind in einem ewigen, reinen und unvcrwirrten Sinn. Auch hier die Inbrunst des Lichtes: »Lodernd, wild, in Nebclmceren ringend, blitzeschlcudernd, sinstcrnisbczwingcnd, reißt die Sonne sich zum Äther los. Sonne, deine Kraft ist grenzenlos!« Auch hier der romantische Laut: »Horch, die Tiere rnsen sich zu Paaren. Aufgewühlter ist des Nachts das Blut, und von tragischen Gefahren kündet mir des Mondes rote Glut«. Auch hier Einsamkeit, deren küsscloscn Mund der Hatz schlictzt. Auch hier der Frieden der Liebe: »Ruhig in dem Licht der Abcndstcrnc sind ich deiner Angen heitre Lust. . .« Die Heimat auch hier, die zu heidnischem Rausch ausloht in der »Westfalcnballade«. Und auch hier, wie gegen Ende des Romans das tiese Gefühl der wüsten und herrenlosen Zeit: ». . . Der Wahnsinn wirft im Bogen von Pol zu Pol sein Nicscnnetz. Propheten haben uns um Gott betrogen, und sinnlos war ihr citelcs Geschwätz. Wann wird der steigen aus dem Himmelsbogen, der, welcher Moses ist, die Tafel, das Gesetz!« — Kurzdcnn, hier istinProsa n ndVerscin Dich Irr tum , das nobel, innig und echt h e r v o r st i ch t ausciner Menge krasser und dreister Windbeutelei unserer Tage. , den blinden Dichter
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht