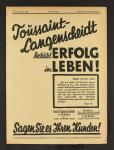Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 15.03.1928
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1928-03-15
- Erscheinungsdatum
- 15.03.1928
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- LDP: Zeitungen
- Zeitungen
- Saxonica
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19280315
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-192803159
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19280315
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1928
- Monat1928-03
- Tag1928-03-15
- Monat1928-03
- Jahr1928
-
-
-
-
-
293
-
294
-
295
-
296
-
2449
-
2450
-
2451
-
2452
-
2453
-
2454
-
2455
-
2456
-
2457
-
2458
-
2459
-
2460
-
2461
-
2462
-
2463
-
2464
-
2465
-
2466
-
2467
-
2468
-
2469
-
2470
-
2471
-
2472 2473
-
2474
-
2475
-
2476
-
2477
-
2478
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
der Titel und Titelbilder. In Kapitel V wird (nicht voll Überzeu gend) über die den ältesten hochdeutschen Perikopenbiichern zugrunde gelegten Missalicn gehandelt, in Kapitel VII die Entstehung der beiden frühesten gedruckten Plenarien (Augsburg, Zainer, 1473 und 1474) klargestellt, in Kapitel VIII das Verhältnis des Neutlinger Plenars von 1482 zu der fünften deutschen Bibel untersucht. Eingeschoben ist als Kapitel VI ein Abschnitt »Zur Wertschätzung der Bibel im ausgehenden Mittelalter«, der zu den besten Teilen des Buches gehört und die größte Beachtung verdient. Von diesem viel- berufenen Thema, dessen wissenschaftliche Erörterung allzuoft durch konfessionelle Voreingenommenheit beeinträchtigt worden ist, hat der Verfasser unter vorsichtigster Erwägung aller Umstände und Mög lichkeiten eine feinfühlige Darstellung gegeben, die in ihrer vor nehmen Zurückhaltung und ruhigen Sachlichkeit hoch über allem steht, was bisher darüber gesagt worden ist, und auf die sich beide Par teien wohl im großen und ganzen einigen könnten. Lediglich ein (untergeordneter) Punkt ist nicht richtig beurteilt: es ist nicht an gängig, aus der großen Zahl der lateinischen Bibeldrncke im 15. Jahr hundert zu schließen, daß »die Zahl der handschriftlichen Bibeln in Deutschland hinter dem Bedürfnis zurückgeblieben war oder wenig stens hinter dem des ausgehenden 15. Jahrhunderts znrückblieb« (S. 287). Es ist vielmehr auf allen Gebieten der Literatur, soweit es sichum ältere Texte h a n d e l t, zu beobachten, daß die im frühen Buchdruck am stärksten vertretenen Autoren und Werke stets diejenigen sind, die auch handschriftlich am meisten Vorkommen, und daß Bücher, deren handschriftliche Verbreitung gering geblieben oder geworden war, auch im frühen Buchdruck keine Nolle spielen. Ab gesehen von vereinzelten Experimenten, die wohl immer auf Rechnung gelehrter Editoren zu setzen und fast ausnahmslos fehlgeschlagen sind, wollten die Drucker der Frtthzeit nicht neue Bedürfnisse wecken, son dern bestehende Nachfrage befriedigen; sie wollten nicht unbekannt gebliebene Schriften einführen, sondern allgemein gebrauchte und begehrte Bücher bereitstellen. Die Menge der Frühdrucke eines älteren Textes steht stets im geraden, nie im umgekehrten Verhältnis zur Menge der nachweisbaren Handschriften desselben Werkes. Wenn man also aus der großen Zahl der lateinischen Bibeldrncke des 15. Jahr hunderts etwas Allgemeines überhaupt schließen will, so kann man nur eine recht große, nicht aber eine zu geringe handschriftliche Ver breitung der Vulgata daraus folgern. — Auf die sprachgeschichtliche Seite des Buches ist an dieser Stelle nicht näher einzugchcn; hier können nur einige Bedenken zu den literarhistorischen Partien geäußert werden, in denen Pietsch zu man cherlei irrigen Vorstellungen und Folgerungen gekommen ist, die ihre Ursache sämtlich in seiner von Anfang an schiefen Einstellung zum Stoff haben. Pietsch ist durch sein Interesse an den Bibclvcrdcutschun- gcn des Mittelalters zu den hochdeutschen Perikopenübersetzungcn ge führt worden und damit zu denjenigen spätmittelalterlichen Büchern, welche solche Übersetzungen enthalten; diese Werke interessieren ihn nicht an sich als literarische Erscheinungen, sondern ganz vorwiegend nur als Träger der Pcrikopenverdcutschungen, sodaß er sie um dieser einen Gemeinsamkeit willen als eine Einheit auffaßt, obwohl es sich dabei um sehr verschiedene Werke handelt. Ferner hat das spezielle Interesse an der Bibelverdeutschung den Verfasser dazu verführt, die Plenarien allzu einseitig als populäre Bibel werke anzusehen, wäh rend sie in Wahrheit als volkstümliche liturgische Bücher zu gelten haben und erst von diesem Gesichtspunkt aus in ihrem Wesen und vor allem in ihrer Entwicklung voll verstanden werden können. Beide Umstände haben es Pietsch unmöglich gemacht, die durchaus klare und folgerichtige Entwicklung der von ihm behandelten Literatur zu erkennen und darzustellen; im folgenden soll versucht werden, dies in aller Kürze nachzuholen. Der Buchtitel »?Ienariuin« bezeichnet im Sprachgebrauch des späteren Mittelalters zwei ganz verschiedene liturgische Bücher: erstens das Lektionar mit den vollständigen Texten der Perikopen (im Gegensatz zum Oomes oder Perikopenverzeichnis) und zweitens das Vollmissale (lUisssIe Plenum oder N. plenarium); dieselben bei den Bedeutungen hatte damals der deutsche Titel »Plenari«, während man heute nur das erste Buch als Plenar, das zweite dagegen als Meßbuch zu bezeichnen hat. Aus der ehemaligen Doppelbeöentung des Wortes folgt sogleich, daß man nicht mit Pietsch S. 60 den Titel »Plenari« als ein maßgebliches Kennzeichen und Unterscheidungs merkmal der Plenarien im engeren (heutigen) Sinne ansprechen darf. Vielmehr ergibt eine Musterung der von Pietsch bearbeiteten Drucke, daß unter einer im wesentlichen gleichbleibenden Titclbezeich- nnng zwei bzw. sogar drei verschiedene Werke Vorkommen. Erstens ein wirkliches Perikopenbuch, das lediglich die Perikopen nebst erläu ternden »Glosen« enthält. Zweitens dasselbe Perikopenbuch mit den selben Glosen, aber vermehrt um eine Übersetzung der beiden ersten wechselnden Teile aller Meßformnlare. Drittens ein vollständiges deutsches Meßbuch mit vollständiger Übersetzung der Meßformulare, auch hier mit Glosen zu den Perikopen, jedoch mit völlig anderen, die aus den niederdeutschen Plenarien übernommen sind. Diese drei Werke treten nacheinander auf; das erste erscheint erstmals 1473 in Augsburg, das zweite zuerst 1488 in Straßburg, das dritte seit 1514 in Basel; das zweite ist einerseits eine Erweiterung des ersten, anderer seits eine Vorstufe des dritten, bas dritte aber (bei Pietsch Klasse II) ist etwas völlig anderes als das erste. Die Entwicklung verlief so, daß sich das Plcnarium Perikopenbuch über eine Zwischenstufe zum Plenarium — Meßbuch erweiterte; daß dem Laien zunächst nur eine Verdeutschung und Erklärung der Perikopen, dann dazu eine Über setzung zweier besonders bezeichnender weiterer Teile der Messe, schließlich eine Übertragung des ganzen Missale an die Hand gegeben wurde. Freilich immer noch mit den »»zugehörigen, populären Zu sätzen der Glosen; der letzte Schritt zum reinen deutschen Vollmissale ohne jegliche erklärende Zutat ist nur noch in Bayern getan (durch das »Missal oder Meßpuech« des Münchener Druckers Hans Schobsser vom 26. Januar 1526), in den übrigen Gegenden aber durch die Re formation verhindert und später von der Kirche nicht mehr zugclassen worden; seit dem letzten Basler »Plenar« von 1522 und dem Mün chener »Missal« von 1526 sind erst in den allerletzten Jahrzehnten wieder vollständige deutsche Übersetzungen des Missale erschienen. Man erhält also eine sinnvolle Entwicklungsgeschichte der gesamten »Plenarien« nur, wenn man sie als liturgische Erscheinungen, niemals aber dann, wenn man sie vorwiegend oder ausschließlich als biblische Volksbücher wertet. Diese ganze Entwicklung hat Pietsch nicht klar erkannt; er hat daher die sämtlichen Drucke vom frühesten Augsburger Perikopenbuch bis zum letzten Basler Meßbuch znsammengeworfen und nur nach Druckstätten und Erscheinungsjahren klassifiziert. Das ist für die rein sprachlich-textliche Untersuchung der Perikopen selbst nützlich (aber durchaus nicht notwendig) gewesen, hat jedoch in jeder anderen Hin sicht dem Verfasser erhebliche Ungelegenheiten bereitet. Die auf der zweiten Entwicklungsstufe neu erscheinenden liturgischen Texte spricht Pietsch als »fremde Bestandteile« an; das Hinzukommen der vollstän digen Mcßformulare auf der dritten Stufe kann er überhaupt nicht erklären. Ta ihm der volksliturgische Charakter dieser ganzen Litera tur nicht klar geworden ist, kann er viele Einzelheiten nicht richtig beurteilen; so S. IX die Passionslesungen, S. 83 die lateinischen Anfangsworte und die Buch- und Kapitelangaben der Perikopen, S. 85/86 die Art der Verweisungen usw., was alles sich bei Heran ziehung des lateinischen Missale von selbst erklärt. Die größten Schwierigkeiten hat Pietsch dauernd mit seiner Klasse H; sie paßt in vielen wichtigen Punkten nicht zu seinen sonstigen Ergebnissen, ihr muß er sehr häufig eine Sonderstellung einräumen (so S. 63, 83, 98, 114, 119 und sonst), was sehr erklärlich ist, da es sich ja hier um ein ganz neues Buch handelt. — Ebensowenig wie den verschiedenen »Plenarien« ist Pietsch dem »Spiegel menschlicher Behältnis« litera risch gerecht geworden; auch er ist für ihn lediglich eine Fundstätte von Perikopenverdeutschungen. Die »Übersicht über den Inhalt« dieses Werkes (S. 103 ff.) ist recht dürftig und läßt den reichen Sachinhalt, den teilweise bis zur Unverständlichkeit komplizierten Auf bau und den inneren Sinn dieses höchst merkwürdigen Buches nicht deutlich werden. Es ist also das letzte Wort über die deutschen Plenarien und die ihnen nächst verwandten Bücher noch nicht gesprochen. Die Forschung wird cs aber nach den mühevollen und umfangreichen Vorarbeiten von Pietsch jetzt verhältnismäßig leicht haben, hier weiterzuarbeiten, und wird insbesondere auf seinen kritischen Textproben nnd sprach- gcschichtlichen Beobachtungen fußen können. Sein Buch enthält trotz einiger Jrrtümer so wesentliche Materialien für eine endgültige Be urteilung der Plenarien, daß dem Verfasser dafür jeder danken wird, der sich mit diesem interessanten Kapitel ans der Geschichte der deut schen Literatur des Mittelalters beschäftigt. Dr. Ernst Schulz, München. UrinlinA. ^ 8Üort Uwtor^ ok tüe ^rt, ecküeck ü. ? 6 ck cl i e. London, IV.C. 1 1S27, Orakton L Co. 8° X u. 390 8. I^xvä. 21 8. Das Werk gibt nicht so sehr, wie vielleicht nach dem Untertitel vermutet werden könnte, wirklich eine Geschichte der Drnckkunst, d. h. der Entwicklung der Drucktechnik und des öruckerlichen Könnens, son dern eine Darstellung der Ausbreitung des Druckgcwerbes nnd seiner Ausgestaltung. Wie in der Vorrede hervorgehoben wird, sollten nicht neue Ergebnisse in selbständiger Forschung angestrebt werden; cs kam vielmehr nur auf eine knappe Zusammenfassung des gegenwär tigen Standes der Wissenschaft an, um dem englischen Interessenten eine rasche Orientierung in dem einen handlichen Bande zu ermög lichen und das mühsame Verfolgen der Originalarbetten, die ja in der Regel weit zerstreut erscheinen, zu ersparen. Zur Mitarbeit 295
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht