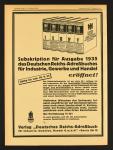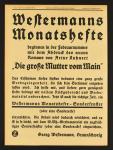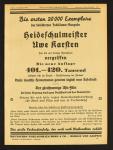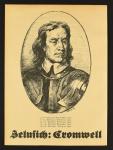Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 13.01.1934
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1934-01-13
- Erscheinungsdatum
- 13.01.1934
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- Zeitungen
- Saxonica
- LDP: Zeitungen
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19340113
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-193401136
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19340113
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1934
- Monat1934-01
- Tag1934-01-13
- Monat1934-01
- Jahr1934
-
-
-
-
-
37
-
38
-
121
-
122
-
123
-
124
-
125
-
126
-
127
-
128
-
129
-
130 131
-
132
-
133
-
134
-
135
-
136
-
137
-
138
-
139
-
140
-
39
-
40
-
-
-
-
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
11, 13. Januar 1834. Redaktioneller Teil. Börsenblatt f. d. Dtschn Buchhandel. der ständig rasch regenerierenden, qualitativ nicht übermäßig diffe renzierten und quantitativ verhältnismäßig rationalen Bcdarss- lagc der Ecnährungswirtschast läßt diese Maßnahme als durchaus nicht gewagt noch aussichtslos erscheinen. Im Gegen teil, es ist zu erwarten, daß sie sich bewährt und behauptet. Freilich wird sie dort, wo die Bedarsslage wie etwa im Buchhandel grundsätzlich völlig anders geartet ist, nie schematisch kopiert und wiederholt werden dürfen. Der Buchhandel zum Beispiel besitzt aber in seinem System des geschützten Ladenpreises bereits eine Ordnung, die in ihrer Art eine ähnliche Aufgabe gelöst hat. Weiter noch führt ein Blick auf die andere Erscheinung, die sich ebenso als ein Stich ins Herz des liberalisti- schcn Systems erweist. Sein vornehmstes Charakteristikum ist die Vertragsidee. Sic wird abgelöst durch den Grundsatz autoritärer Ordnung. In diesem Sinn wird künftig auch alles Gewohnheits recht und alle Vcrkehrssitte, die bisher aus Verträgen erwuchsen, im Rahmen der sich selbst verwaltenden Wirtschaft in ihrer stän dischen Gliederung autoritär gesetzt werden, dem Geist gemäß, der das Ganze beherrscht und durchglüht. Dem Buchhandel ist das nahe liegend genug. Im Grunde erhält damit nur jene Ncxusidcc deutlichsten Ausdruck und höchste Kraft, die schon Pütter im 18. Jahrhundert als hervorstechendstes Merkmal gerade des deutschen Buchhandels erkannt und die durch alle Wandlungen der Jahr hunderte sein Schicksal immer wieder maßgeblich bestimmt hat. Es kann dem deutschen Buchhandel also nicht schwcrfallen, sich auf die neue Zeit wirklich bewußt einzustellen. Das aber wird er in allen Gliedern in der Tat tun müssen, mehr noch als es vielleicht hier und da bisher der Fall gewesen sein mag. Don der Bielleserei zum Deutschlesen. Von I)i-. Walter Rumpf. »Macht Deutschland stark in den Seelen deut scher Menschen und lasst sie dann in vielen Zun gen von seiner Kraft und seinem Adel reden.« Wilhelm Michel. »Vates« — Seher — nannte man im Altertum die Dichter und machte damit sinnfällig ihren Unterschied von all den Lohnschreibern und Literaten, die sich der Kunst des Wortes nur selbstgefällig oder- rein gewerbsmässig bedienten. Vates, das sind die von Gott be gnadeten, die Menschen mit dem »zweiten Gesicht« und Franziskus- natnren, denen gegeben ist zu verstehen und zu reden die Sprache der Bäume und des Wassers und der Vögel, denen zuteil wurde die Schöpfergabe der Verdinglichung des Wortes, das da mehr ist als eitel Rede und nicht vergänglich wie Schall und Rauch. Sie sind die blinden Sehenden, aber nicht mit Augen Sehenden, wie Hermann Stehr einmal unvergleichlich sagte, nein, die sehen »mit der Seele. So, damit sehen wir alle. Die Augen sind ein Umweg. Und was wir in der Seele sehen ist ein anderes, als die Welt in unseren Augen. Deswegen gibt es hinter der Augenwelt noch eine Welt. Und jedes Ding ist doppelt. Und während ich lebe, lebe ich zugleich hier und wie hinter fernen Büschen«. So spricht ein Dichter und das ist das Sehen des Dichters! Das aber läßt sich nicht einfach lernen und hernmtragen in der Welt, wie ein Neisekoffer, das ist hineingesenkt in den Menschen wie das Samenkorn in die Erde und wie dieses reift oder verkümmert, je nach der Beschaffenheit des aus nehmenden Bodens, so auch der Mensch, der Dichter! Es ist nicht gleichgültig, ob er in der heißen oder kalten Zone, im Gebirge oder Flachland, am Meere oder an den Ufern eines Flusses seine Heimat fand, wie es nicht gleichgültig ist, wer mein Vater ist und meine Mutter, was meine Liebe und was mein Haß. In der modernen Medizin spricht man von »Dispositionen« für eine Krankheit und versteht darunter eine innere Beziehung zwischen Krankheitskeim und dem Organismus des Menschen, also einer Empsängnisbereit- schaft. Und ist es nicht genau so im Seelischen? Wie anders sehen und erleben wir die Umwelt an einem grauen feuchten Herbsttage, wenn Nebel alle festen Umrisse auslösen in eine wogende und ver- schwebende Ungewißheit, wie anders, wenn im Frühling die Bächlein von den Bergen springen und das frische Grün zarter Schößlinge neues Leben kündet. Auch unser seelisches Erleben hat seine Bereit schaft und darum kann man auch echte Dichtung nicht einfach auf nehmen nach Belieben und in sich schlürfen wie ein Getränk. Man muß innerlich dazu gestimmt sein, wie die Saite eines Instrumentes, man muß ein Gefühl dafür haben, ob die rechte Stunde da ist, andernfalls man sein Buch besser weglegt, bis sie kommt. Das aber ist ja das Verhängnis unserer Vergangenheit, daß wir in unserem seelischen Erleben mit hineinschlitterten in das allgemeine Chaos der Gleichmacherei und Mechanisierung. Wir haben die Sprache unserer Dichter nicht mehr verstanden und fremd blieb sie unserem Ohr wie ein Laut aus einer anderen Welt, unvernommen rauschte sie vorüber an unserer Seele. Das Wort war herabgesunken zum Werkzeug des Ungeistes und Wider geistes. Man spricht heute viel von dem »Pluralismus der Wcrte« als kennzeichnend für den Geist des Liberalismus und meint damit jene Haltung des Alles-gelten-lassens und den Triumpf der soge nannten »Wertfreiheit«, deren letztes Ergebnis nur ein grauenvoller Nihilismus sein konnte. An die Stelle der Dichtersprache war eine farblose Allerweltssprache ohne Saft und Kraft getreten, an Stelle der Dichter führten die Schreiber das Wort und gefielen sich in geistreicher Wortspielerei. Für sie war es allerdings' gleichgültig, ob sie in Berlin oder Paris oder Prag lebten, ob sie französisch oder- deutsch oder englisch schrieben, es waren Sprache und Milieu der internationalen überall gleichen »Gesellschaft« volksfremder und wurzelloser Elemente. So sieht der Pluralismus in der Literatur — denn »Dichtung« war das ja nicht — aus, wahre Dichtung aber heißt nicht Vielwertigkeit oder Gleichmacherei, sondern Man nigfaltigkeit, wie sie vielleicht kein Volk in solcher Fülle anf- zuweisen hat wie das deutsche. Der Wiener Literarhistoriker Josef Nadler hat uns in seinem Werk der »Literaturgeschichte der deut schen Stämme und Landschaften« mit der kongenialen Gabe des wahrhaft volkhasten Menschen aufgezeigt, wie das gemeint ist, er hat uns dargetan, wie Volktum, Raum, Dichtung aufs engste zu sammengehören, wie die deutsche Dichtung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart ein einziges und einzigartiges Bekenntnis ist der Dichter zu Heimat und Volk und Vaterland. Wer das nicht spürt, der hat noch nicht hineingehört in die letzten Tiefen deutscher Dichter sprache und der wird es auch nicht verstehen, daß ein Stehr und Wiechert und Carossa und all die Künder eines »heimlichen Deutsch lands«, wie Werner Mahrholz sie einmal treffend nannte, so und nicht anders schreiben können, wie sie es tun. Und darum sind ihre Werke eigentlich auch unübersetzbar, raum- und erdgebunden wie ein Rebstock. Denn wie man einen Nüdesheimer oder Bernkastler nicht verpflanzen kann an die Rhone oder Saar, so kann man einen Stefan George oder Stehr oder Schaefer oder Paul Ernst nicht ein fach ins Französische oder Englische übersetzen, ohne ihnen das We sentlichste zu nehmen. Dessen aber müssen wir auch innewcrden bei der Lektüre, wir müssen endlich loskommen von der stoffhnbernden Vielleserei und Modesucht, immer die letzte Neuerscheinung zu kennen. Es ist wirklich belanglos zu missen, was dieser oder jener Literat über das »soziale Problem« des kleinen WarenhanSmädchens oder die sexuelle Not der Jugend zu sagen hat, denn auf eine Lösung oder ernsthafte Erörterung dieser Fragen kommt es dabei meist gar nicht an und viel wichtiger ist solchen Leuten die Freude am Wühlen im Unrat und die Spekulation ans die niedersten Instinkte. Dem ist nun heute Gott sei Dank ein Damm cntgegengestellt. Die Dichtung wird wie der Angelegenheit des ganzen Volkes und ist nicht mehr die eines kleinen Kreises gelangweilter und verbildeter Snobs, die da glau ben, die wahre Volksdichtung abtun zu können als eine solche des »total platten Landes«, wie es tatsächlich noch im Jahre 1932 ge schehen ist, und zwar nicht in einer Boulevardgazette, sondern in der Akademie der deutschen Dichtung. Weder die Dicke eines Buches noch die Sensation des Stoffes machen seinen eigentlichen Wert aus, im Gegenteil, eine kleine, knapp einhundertseitige Erzählung Kleists, der Droste, Stifters oder N. G. Bindings ist meist gehaltvoller als ein mehrhundertseitiger Schmöker über ein sogenanntes »aktuelles Problem«. Es ist wich tiger, in drei Wochen e i n wahrhaft dichterisches oder ernstes Werk zu lesen, als dieselbe kostbare Zeit an ein Dutzend übermorgen schon wieder vergessener Machwerke zu vergeuden. Praktisch gesprochen: es ist Pflicht jedes Deutschen, daß er des Führers Buch »Mein Kampf« nicht nur durchgeblättert, sondern wirklich in sich ausgenom men hat und demgegenüber verschlägt es nichts, wenn er keinen Be scheid weiß über den neuesten Nomanfchlager des Bnchmarktes. Es ist lächerliche tlberhobenheit, wenn man glaubt, ein schon älteres Werk einfach als überholt abtun zu können. Wir müssen wieder dahin kommen, daß wir das Bedürfnis haben, mit unseren Freun den und Bekannten über Dichtung zu sprechen, ihnen gute Bücher zu empfehle« und sie auf solche hinznweisen, die uns zum Erlebnis wurden. Das heißt Deutschlesen. Das heißt eines Dichtwerkes innewerden im ganz konkreten Sinne des Wortes, daß wir beim Lesen eines Buches innige Liebe und Wärme empfinden bis in den Bau eines Satzes und die Wahl der Worte, daß ihr Rhythmus über springt in unsere Seele und sie mitklingen macht wie es im Dichter schwang in der Gnadenstunde seines Schöpfertumes. Dahin müssen wir wieder kommen. Dann erst sind wir auch wieder aufnahmebereit 39
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht