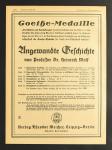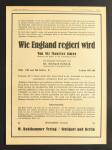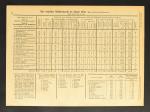Börsenblatt für den deutschen Buchhandel : 28.05.1936
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Band
- 1936-05-28
- Erscheinungsdatum
- 28.05.1936
- Sprache
- Deutsch
- Sammlungen
- Zeitungen
- Saxonica
- LDP: Zeitungen
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id39946221X-19360528
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id39946221X-193605283
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-39946221X-19360528
- Nutzungshinweis
- Freier Zugang - Rechte vorbehalten 1.0
- Lizenz-/Rechtehinweis
- Urheberrechtsschutz 1.0
Inhaltsverzeichnis
- ZeitungBörsenblatt für den deutschen Buchhandel
- Jahr1936
- Monat1936-05
- Tag1936-05-28
- Monat1936-05
- Jahr1936
-
-
-
-
-
477
-
478
-
479
-
480
-
2685
-
2686
-
2687
-
2688
-
2689
-
2690
-
2691
-
2692
-
2693
-
2694
-
2695
-
2696
-
2697
-
2698
-
2699
-
2700
-
481
-
482
-
483
-
484
-
-
-
-
- Links
-
Downloads
- PDF herunterladen
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
anzufertigen. Daß die Schallplatte nicht (wie nach Z 2 Abs. 2 LUG. und nach dem früheren österreichischen Urheberrechtsgesetz) als Bearbeitung, sondern als Vervielfältigungsstück des darin festgehaltenen Werkes angesehen wird, entspricht auch deutscher Auffassung. 2. Das Verbreitungsrecht bedeutet das dem Urheber vorbehaltene Recht, das Eigentum an Bervielfältigungsstücken des Werkes gegen Entgelt auf Dritte zu übertragen; darüber hinaus aber — und hierdurch unterscheidet sich das österreichische Gesetz wesentlich von unserem Urheberrechtsgesetz — bezweckt die Nor mierung dieses Rechts »im Kreise der Rechte, die es dem Urheber Vorbehalten, das Werk an die Öffentlichkeit zu bringen, den Sektor zu schließen, der nicht schon durch die ausschließlichen Rechte aus gefüllt wird, das Werk durch öffentlichen Bortrag, Aufführungen, Vorführungen, durch optische Einrichtungen oder durch Rundfunk sendung wahrnehmbar zu machen». Damit wird ausgesprochen, daß dieses Verbreitungsrecht einen umfassenden Sinn haben, überall dort eintreten soll, wo es sich um irgendwelche Verwen dung von Festlegungsstücken des Werkes handelt. Hier wird also — ohne daß ein rechter Grund vorliegt — der Grundsatz der fest umrissenen urheberrechtlichen Teilrechte verlassen. 3. Das Senderecht bedeutet das dem Urheber vorbe haltene Recht, das Werk durch Rundfunk oder aus ähnliche Art zu senden, worunter auch das Fernsehen fällt. 4. Das Vortrags-, Aufführungs- und Borfüh rungsrecht bedeutet das dem Urheber vorbehaltene Recht, sein Werk tonlich oder bildlich wiederzugeben, wobei mit Recht es als gleichgültig erachtet wird, ob diese Tonwiedergabe un mittelbar (also insbesondere durch Menschen) erfolgt oder mittel bar mittels einer bereits sestgehaltenen Wiedergabe des Werkes (z. B. durch eine Schallplatte). Nach ausdrücklicher Vorschrift wird die Bernehmbarmachung einer Rundfunksendung durch Lautsprecher als Aufführung an gesehen und ist demgemäß dem Urheber gegenüber tantieme pflichtig (also entgegen der deutschen und italienischen Recht sprechung). Als ein Mangel muß es aber bezeichnet werden, daß das österreichische Gesetz, wenn es schon einmal diese Lautsprecher- Vernehmbarmachung tantiemepflichtig gemacht hat, nicht gleichzeitig diesen Tatbestand als Eingriff in das Recht der Sendegcsellschaft an der Sendung gekennzeichnet und somit die gewerbliche Tätigkeit der Sendegesellschaft, in die primär eingegrifsen wird, geschützt hat. 5. Das Bearbeitungsrecht wird dahin richtig gekenn zeichnet, daß der Urheber einer Bearbeitung diese lediglich dann verwerten kann, wenn ihm der Urheber des bearbeiteten Werkes das Recht hierzu erteilt hat. Damit wird ausgedrückt, daß der Bearbeiter lediglich hinsichtlich der Ausübung der positiven ur heberrechtlichen Befugnisse einer Bewilligung des Urhebers des Ur-Werkes bedarf, während die negativen Befugnisse wie auch das Urheberpersönlichkeilsrecht dem Bearbeiter kraft seiner Bearbeiter schaft zustehen. lll. Während die vermögensrechtlichen Interessen vom Gesetz als Verwertungsrechte bezeichnet und diese einzeln normiert werden, fehlt es an einer gleichen Kennzeichnung und Normierung für das, was wir im deutschen Recht Urheberpersönlichkeitsiecht nennen und wofür im deutschen Schrifttum einzelne Auswirkungen als richtunggebend anerkannt werden. Das österreichische Gesetz be gnügt sich von einem Schutz geistiger Interessen zu sprechen und als solche Schutzauswirkungen den Schutz der Urheber schaft, die Urheberbezeichnung (also nicht Schutz der Urheberbezeich nung) und den Werkschutz (nämlich gegen Abänderungen) fest zulegen. l. Es fällt zunächst auf, daß das österreichische Gesetz die wich tigste Ausübung des Urheberpersönlichkeitsrechts, nämlich das Ver öffentlichungsrecht, nicht normiert hat (welches das frühere öster reichische Gesetz als vermögensrechtliche Befugnis kannte). Dieses Recht ist, wie die herrschende Lehre im Deutschen Reich, besonders aber auch das französische Schrifttum mit besonderem Nachdruck ausgeführt hat, das Primäre an jedem Urheberpersönlichkeitsrecht. Denn erst durch seine Ausübung wird das Werk der Geheimnis sphäre seines Schöpfers entrissen und als Ware in den Wettbewerb der Geistesgüter hineingestellt. Solange das Werk nicht veröffent- 478 licht ist, können die Berwcrtungsrechte nicht ausgeübt werden. Jede erstmalige Ausübung eines Verwertungsrechts schließt die Ver öffentlichung des Werkes in dieser Richtung in sich. Wenn das österreichische Gesetz dagegen (H ll Abs. 2 LUG. folg.) als vermögensrechtliche Befugnis (!) dem Urheber das Recht an der öffentlichen Mitteilung des Inhaltes eines Werkes der Literatur oder der Filmkunst Vorbehalten hat, solange weder das Werk noch dessen wesentlicher Inhalt veröffentlicht ist, so wird damit nur ein unwesentlicher, praktisch fast bedeutungsloser Aus schnitt aus dem wichtigen Vcröffcntlichungsrechte geregelt, und dazu noch irrig als Vermögensrecht. 2. Der Schutz der Urheberschaft, die Urheberbezeichnung und der Werkschutz sind ganz im Sinne des deutschen Rechts geregelt worden. Bet dem Werkschutz hebt das Gesetz durchaus beisallS- würdig hervor (weil damit die Interessen des einzelnen und der Allgemeinheit gerecht gegeneinander abgegrcnzt werden), daß solche Änderungen des Werkes durch den Verwerter gestattet sind, die der Urheber nach den im redlichen Verkehr geltenden Ge wohnheiten und Gebräuchen nicht untersagen kann, insbesondere solche Änderungen, die durch die Art und den Zweck der erlaubten Werlnutzung gefordert werden; andererseits aber wird der Ur heber, wenn er seine Einwilligung zur Vornahme einer Abände rung erteilt hat, nicht daran gehindert, solche Abänderungen trotz dem zu untersagen, die seine geistigen Interessen am Werke schwer beeinträchtigen. Denn hier stehen neben den persönlichen Inter essen der Urheber die gewichtigen Interessen der Allgemeinheit daran, daß das Werk in seiner Festlegungsform erhalten bleibe. IV. Das Urheberrecht ist grundsätzlich unübertragbar, und zwar sowohl hinsichtlich der einzelnen Berwertungsrechte als auch des Schutzes der geistigen Interessen. (Nach dem alten öster reichischen Urheberrechtsgesetz war das Urheberrecht der Substanz nach unübertragbar, wohl aber der Ausübung nach.) Von dieser Grundregel aber gelten drei Ausnahmen: 1. Das Urheberrecht istvererblich und kann auch in Aus führung einer Verfügung von Todes wegen auf den Vermächtnis nehmer übertragen werden, und zwar sowohl die Verwertungs rechte als auch der Schutz geistiger Interessen. Diese Vererblichkeit und Übertragbarkeit von Todes wegen gilt sowohl für das Urheber recht als Ganzes wie auch für einzelne seiner Rechte. In der Hand der Erben oder Vermächtnisnehmer dagegen ist das Urheberrecht wieder unübertragbar bis zum Augenblick des Todesfalles. 2. Nun hat natürlich auch der österreichische Gesetzgeber nicht verkannt, daß die Praxis der Verwertung von Urhcberrcchtsgut zwingend eine Übertragung der einzelnen Rechte fordert, um dem Erwerber eine Garantie vor Eingriffen Dritter in das ihm über tragene Recht zu geben. Dem steht nun die Doktrin von der Un übertragbarkeit des Urheberrechts und der einzelnen Verwertungo- rechte entgegen. Zum Ausgleich dieser beiden Tendenzen hat der österreichische Gesetzgeber folgende Konstruktion gewählt (die vom rein rechtlich-konstruktiven Standpunkt aus durchaus geglückt ist): Das österreichische Gesetz läßt eine Belastung der einzelnen Verwertungsrechte zu. Die Belastung kann dinglicher (also mit Wirkung gegen jeden Dritten) oder obligatorischer Natur (also nur mit Wirkung gegen den Belastenden, etwa gleich unserer einfachen Lizenz) sein. Die dingliche Belastung heißt Werknutzungs recht, die obligatorische Werknutzungsbewilligung. Wenn also der Urheber z. B. der Autorengesellschast ein Recht an seinem Werk übertragen will, so überträgt er bei uns z. B. das Aufführungs recht an die Stagma. Der österreichische Komponist kann das Auf führungsrecht an die AKM. nicht übertragen, denn das Aufführungs recht ist unübertragbar. Wohl aber kann er sein Urheberrecht mit einem Werknutzungsrecht des Inhaltes belassen, daß die AKM. aus schließlich und mit Wirkung gegen jeden Dritten das Aufführungs recht benutzt. Praktisch kommt das auf das Gleiche hinaus wie die Übertragung des Aufführungsrechts, aber juristisch bedeutet diese Belastung des Urheberrechts durch jenes Werlnutzungsrecht, daß auch das Aufführungsrecht zur Gänze beim Komponisten ver bleibt, allerdings der Wirkung nach gänzlich ausgehöhlt durch das Werknutzungsrecht. Weil diese Werknutzungsrechte Belastungen des Urheberrechts sind, so richtet sich deren Inhalt (genau wie beim deutschen Ber- lagsgcsetz) nach dem zugrundeliegenden Vcrpslichtungsgeschäft.
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht